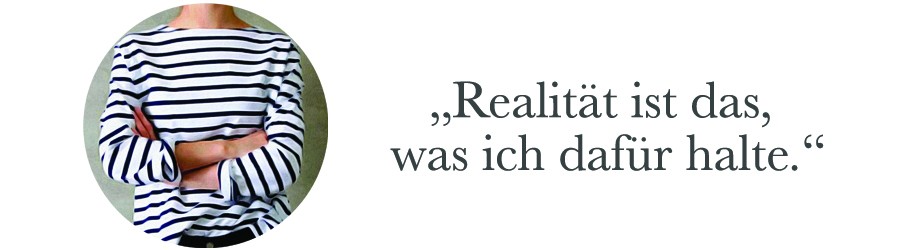Ich hatte es lange nicht mehr. Dieses Gefühl. Nein, mehr als nur ein Gefühl. Ein Signal, das einem der eigene Körper sendet. Ein Dröhnen, das aus dem tiefsten Innern zu kommen scheint. Ein Rattern und Flimmern. Eine dieser sich drehenden Alarmleuchten, die erst langsam und dann immer schneller rotiert. Irgendwo in der Ferne hält das Gehirn ein Schild hoch, auf dem mit zittriger Hand „Überreizung“ geschrieben steht. Keine Ahnung, wie lange es da schon so steht, ich sehe es meistens zu spät. Ein Umstand, den ich ausnahmsweise nicht auf meine Kurzsichtigkeit schieben kann, sondern der eher dem angelernten Wegschieben, dem Ignorieren, dem tief in meine Seele eingefrästem „Stell-dich-nicht-so-an“ zu verschulden ist.
Es ist nicht wirklich ein Wunder oder Überraschung, dass es diese Woche das erste Mal seit Monaten wieder auftritt. Nicht, dass ich in den vergangenen Monaten ein in sich ruhender Sonnenschein gewesen wäre, dessen Visage man super mit einem Konfuzius-Spruch auf Postkarten hätte drucken können. Eher das Gegenteil.
Aber diese Woche ist das erste Mal seit Monaten, dass ich jeden Tag bis zum Mittag unter Menschen war und bin. In einer Gruppe, einem sozialem Gefüge, in dem ich nicht ich sein kann oder denke, dass ich nicht ich sein kann, also maskiere, also jemanden spiele, dem es nichts ausmacht knapp 5 Stunden mit einem Dutzend Menschen in einem Raum zu sitzen und ununterbrochen zu interagieren. Blickkontakt, nicht zu lange, nicht zu kritisch gucken, nicht „böse“ gucken, daran denken, die Kiefer nicht die gesamte Zeit aufeinanderzupressen und die Zunge gegen die Schneidezähne zu drücken. Zuhören, nicken, den inneren Katalog an passenden Mimiken abklappern.
Schon wenn ich nach Hause fahre, merke ich wie alles kribbelt, als stünde man direkt unter der Haut unter Strom. Der Kopf rattert, aber man kann den Gedanken nicht folgen, sie sind zu schnell, vielleicht sind es auch gar nicht die eigenen Gedanken, sie sind einfach da, düsen von links nach rechts, rasen kreuz und quer, es ist ein permanentes Flüstern, das sich in ein Rauschen verwandelt. Das Herz schlägt schneller oder atmet man schneller oder bildet man sich beides nur ein? Jeder Muskel, jede Faser, scheint angespannt, auch sie scheinen nicht zu einem selbst zu gehören, denn sonst würden sie doch sicher auf einen hören, wenn man ihnen sagt, dass sie mal bitte chillen sollen. Die Blinkhäufigkeit nimmt zu – die eigene, nicht die des Autos. Und da in demselben sonst kein Stimming möglich ist, gibt’s ne Runde Skin Picking frei aufs Haus.
Zuhause ist der Drang, sich mindestens bis zum Abend – mit Ohrstöpsel und Augenmaske bewaffnet – in eine Betthöhle zurückzuziehen, verlockend bis unwiderstehlich.
All das ist einerseits vertraut, die Signale sind nicht unbekannt, das Wissen, was passiert, wenn ich sie zu lange oder generell ignoriere, ebenfalls. Und dennoch – oder gerade deswegen – sind sie auch bedrückend. Die erneute Bestätigung der eigenen körperlichen Grenzen bei etwas, was so lapidar scheint, macht betroffen und auch ein wenig wehleidig.
Aber es sind am Ende weniger die eigenen körperlichen Grenzen, die einen wehleidig werden lassen. Sondern die Gewissheit, dass man weiterhin anders ist, dass die Räume, in denen man wortwörtlich und metaphorisch funktionieren muss, nicht für ‚anders‘ geschaffen sind – und dass sich an beidem so schnell auch nichts ändern wird.