20:16 Uhr. Sitze mit Block und Füller auf dem Bett. Sortiere meine Gedanken. Der Hund hinter mir, an meine Hüfte getackert, als hätte ein erfahrener Chirurg ihn mit unsichtbaren Fäden an mich genäht. Er – der Hund, nicht der Chirurg – hofft offenbar, ich würde mich an seine aufdringliche Nähe schnell gewöhnen, damit ich ihn nicht des bettes verweise. Nur mäßig unauffällig rutscht er noch einen halben Milimeter näher, vermeidet dabei Blickkontakt, als solle ich ihn nicht beachten, als wäre er schon immer da und gehöre auch nirgendwo anders hin, so wie ein semi-erfolgreich absorbierter Zwillingsfötus, den man wie eine Hüfttasche aus den Neunzigern weiter mit sich herumträgt und keine Fragen mehr stellt.
„Das ist Bob“, würde ich zu den Leuten sagen, wenn sie mal wieder komisch auf meine Zwillingszellenbreihüfttasche schauten, aber eigentlich machte das keinen Unterschied, denn ob mit oder ohne Namen, sie würden weiterstarren, aber mir wäre es egal, denn ich hatte mich ja an ihn gewöhnt. An Bob.
So in etwa stellt der Hund sich das wohl vor, wenn er so ganz nah und ganz dicht bei mir liegt. Ich gehöre hier hin, nirgendwohin sonst und erst recht nicht runter vom Bett und rein ins Körbchen. Er ist ganz still, so still wie Bob eben auch sein würde.
Am Anfang des Textes wollte ich auf irgendwas hinaus, also irgendwas anderes als die Sache mit Bob. Aber mir fällt es nicht mehr ein – das Einzge, was mir nun durch den Kopf geht, ist die Frage, ob es wirklich so absurd wäre, einem Hund solche Gedankengänge zu unterstellen – oder ob er genau das will. Dass wir weiterhin nicht auf die Idee kommen, dass er sowas denken könnte. Weil er sonst sein Ziel, das ganz-nah-bleiben, verfehlen würde.
Da mir weiterhin nicht einfallen will, worüber ich eigentlich schreiben wollte, als ich zu Block und Füller griff, höre ich nun lieber auf und verwende die übrig gebliebende Energie des Tages, die eh nur noch wenig vorhanden ist, dem Hund tief in die Augen zu blicken und auf ein Zeichen des Ertapptwerdens zu warten.
#BlogLikeNoOneIsReading
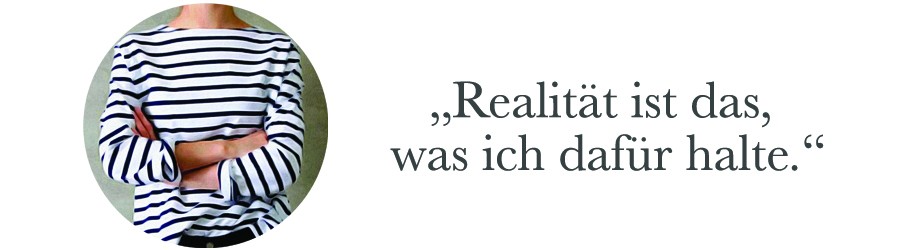
:)