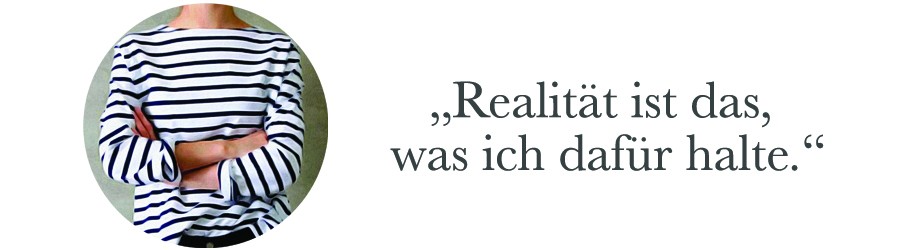Es ist 4.19 Uhr. Morgens. Nachts. Neben mir steht ein heißer Nesquik-Kakao. Ein Kaffee schien mir um diese Uhrzeit dann doch zu extrem. Ich bin wach. Offensichtlich. Anders ließe sich das Tippen und die Anwesenheit des Kakaos nur mit Schlafwandeln oder einer tiefergehenden Erkrankung erklären.
Ich muss in solchen Nächten häufig an einen Beitrag denken, den ich vor vermutlich Jahrzehnten im analogen Fernsehen gesehen hatte. Allein der Umstand, dass es im analogen Fernsehen war, führt mich zu der Annahme, dass es Jahrzehnte her sein muss. Es war sicherlich eine der nur so lala wissensbringenden Sendungen wie Galileo, vielleicht aber auch eine tatsächlich wissensbringende Reihe wie Sendung mit der Maus. Es ging ums Schlafen. Und um irgendwelche namenlose Menschen, die damals 100 Mark oder sonst einen enormen Betrag dafür bekommen haben, dass sie sich beim Schlafen filmen lassen. Klingt erstmal komisch, ist es aber so.
Man ließ sich also beim Schlafen filmen. Irgendwo von der Decke aus. Alles ganz züchtig. (Also auf eine andere Weise züchtig als bei Wa(h)re Liebe, ebenfalls eine Sendung aus der Prä-Stream-Ära, bei der es auch ganz viel um Wissensvermittlung und Dinge, die man im Bett tun kann, ging.) In diesem züchtigen Beitrag wurde dann neben der visuellen Veranschaulichung erklärt, warum die eigene Bettdecke und man selbst in der Regel irgendwann ganz woanders liegen, als zu dem Zeitpunkt als man sich hingebettet hat. Kurzum: Der Mensch wälzt sich im Schlaf, der eine weniger, der andere, als ob er für die Aufnahmeprüfung beim Cirque du Soleil trainieren würde. Ich fand das damals hochspannend. Was vor allem daran lag, dass ich mich nicht wälze.
Ich wache auf. Mehrmals in der Nacht. Weil ich solange in derselben Position schlafe, bis es anfängt unangenehm zu werden oder wehzutun. Meistens das Becken oder der Rücken. Also wache ich auf, weil ich mich eben nicht im Schlaf wälze und damit unterbewusst und sanft träumend meinen Körper in eine andere Position wuchte. Ich wache auf, merke ‚Oha, das Iliosakralgelenk sagt Moin‘ und dann drehe ich mich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte von der rechten auf die linke Seite oder andersherum und positioniere neben meinem Körper auch Kissen, Decke und Hund neu.
Ich versuche dabei die Augen zuzulassen, um mein Gehirn in der Illusion zu wiegen, wir würden alle noch schlafen. Meistens klappt das und mein Körper schläft danach wieder ein, noch bevor mein Gehirn auf Betriebstemperatur gekommen ist. Manchmal nicht. Je nach Uhrzeit greife ich dann zu meiner kleinen Melatonin-Flasche und gönne mir einige Sprühdosen in der Hoffnung, das V8-mäßige Aufheulen meines Gehirn frühzeitig wieder einzudämmen.
Heute Morgen merkte ich jedoch recht schnell: Das Gehirn hat nicht nur den Motor bereits angeworfen, es ist schon draußen auf der Rennstrecke, dreht seine Runden und hat nicht vor so schnell einen Boxenstopp einzulegen. Dagegen ist dann selbst Melatonin machtlos.
Ich muss regelmäßig an diesen TV-Beitrag denken. Vielleicht, weil er einer von vielen ist, der zeigte oder den Anspruch hatte, zeigen zu wollen, was die Norm ist, wie sich der komplett durchschnittliche Mensch in einer komplett durchschnittlichen Situation verhält. Und ich damals dachte ‚Aha, aha, interessant‘, während sich das erste Mal das Gefühl einschlich, dass der eigene Körper sich Nacht für Nacht offenbar überhaupt nicht komplett durchschnittlich verhielt.
Man mag von solchenn Beiträgen und ihrem wissenschaftlichen Anspruch halten, was man mag – es sei denn, der Beitrag war tatsächlich aus der Sendung mit der Maus, dann verbittet sich jede potentielle Kritik an der Wissenschaftlichkeit und dem Motiv des Aufklärenwollens –, was bleibt ist die erstmalige Auseinandersetzung mit der Frage: Wie durchschnittlich bin ich? Und auch wenn in den Jahren meiner psychologisch durchaus auffälligen Kindheit sicher das ein oder andere Indiz für die Beantwortung dieser Frage aufgeploppt ist, war es dennoch das erste Mal, dass ich mir selbst diese Frage stellte.
Sich in den Neunzigern so eine Frage zu stellen, war in der Regel unerquicklich. Man lebte in einer Zeit, in der Depressionen lediglich eine Frage der Einstellung waren und jenseits von Schizophrenie und Psychopathie –, Begriffe mit denen der durschnittliche Deutsche so viel medizinisches Fachwissen verband wie man in eine Folge CSI packen konnte – kein Bewusstsein für eine neutrale Form der Andersartigkeit existierte. Anders zu sein war grundsätzlich erstmal von pathologischer Natur.
Wenn man also nicht durchschnittlich war, nicht der Norm entsprach, hatte man sich anzupassen und bitte durchschnittlich zu wirken und wenn man das nicht wollte, war man verzogen und/oder aoszial, und wenn man das nicht konnte, war man vor allem eines: falsch.
Dieses Gefühl, dieses untrennbare Verwobensein von anders und falsch, ist tief in mir verwurzelt und lässt mich auch weiterhin nicht los. Inzwischen kann ich zwar auf rein rationaler Ebene anerkennen, dass das vermeintliche Anderssein, das Nicht-durchschnittlich-sein, nicht mit falsch gleichzusetzen ist. Jedoch … Tief in einem drin, dort wo kaum ein Licht hinkommt und alte Gefühle wie Kaspar Hauser verwildert hausen, ausgesperrt von allem, beinahe schon verkrüppelt – dort ist der Gedanke immer noch lebendig. Wie eine kleine Flamme, die durch die verwilderte Traurigkeit und vernachlässigte Wut weiterhin Sauerstoff erhält. Eben gerade so viel, dass sie nicht erlöscht.
Es ist 5.02 Uhr nachts. Morgens. Ich werde mich gleich fertigmachen, die Spülmaschine ausräumen und andere Dinge erledigen. Dann mit dem Hund rausgehen und mich dann an den Schreibtisch setzen. Vermutlich werde ich irgendwann nach 9 Uhr (morgens) hundemüde werden. Vermutlich werde ich den Drang haben, mich hinzulegen und zu schlafen, wohlwissend, dass es kein Powernap werden wird. Sondern dass ich erst aufwachen werde, wenn mein Becken schmerzt. Vielleicht werde ich mich dann noch einmal umdrehen und erst am Nachmittag aufstehen. Vielleicht werde ich dann bis in den tiefen Abend all die anderen Dinge erledigen, die der durchschnittliche Mensch tagsüber erledigt oder von dem ihm erzählt wird, dass man sie tagsüber erledigen sollte, weil die Nacht zum Schlafen und sich Wälzen vorgesehen ist. Vielleicht lese ich dann noch die halbe Nacht Haffners Anmerkungen zu Hitler, vielleicht schlafe ich auch direkt ein, bis mich mein Rücken daran erinnert, dass ich mich mal wieder bewegen sollte im Bett.
Und nichts an alldem ist (sagen wir es gemeinsam) falsch.