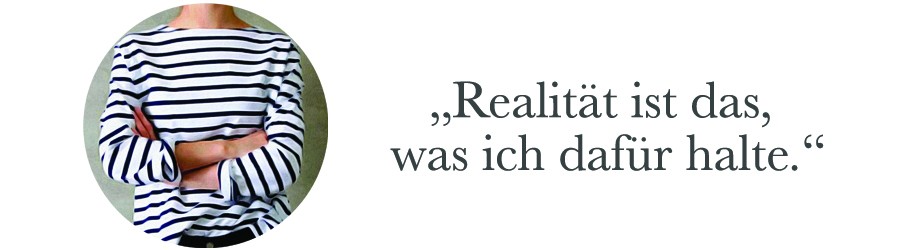New year. New me. New me? Pffth …
So ein Jahreswechsel ist ja häufig mit Erwartungen verbunden. Nicht an das Neue Jahr persönlich – was soll es auch konkret machen, es lümmelt sich in unser Leben, existiert passiv wie eine Alge im Aquarium vor sich. Und wie bei Erwartungen an Algen halte ich auch Erwartungen an das Neue Jahr für ein bissel naiv.
Es ist dieser geradezu esoterische Aberglaube, dass man selbst ein komplett anderer, nein besserer Mensch wird, sobald man diese fiktive Stufe ins Neue Jahr gemeistert hat. Als wäre das Umschlagen des Kalenderblatts ein ähnlich verzauberter Akt wie der Mitternachtsgong in einem Disneyfilm.
Stattdessen wacht man doch am 01.01. als derselbe Mensch auf, dessen Haupt man wenige Stunden zuvor hernieder gebettet hatte. Gut, nicht selten mit Restalkohol in der Blutbahn, unverdaulichem Käse irgendwo zwischen Magen und Darm, einem nicht unerheblichen Schlafdefizit und – je nachdem, ob einem die schier endlosen Möglichkeiten der natürlichen Selektion in der Silvesternacht vorher bewusst waren oder nicht – weniger Fingern. Aber ansonsten: Derselbe Mensch.
Jedoch, high von dem Placebo-Neujahrs-Effekt, merkt man dies nicht. (Vielleicht spielt da auch der Restalkohol eine Rolle. Genauere Studien diesbezüglich laufen bereits.) Schließlich war die Überzeugung, dass man am 01.01. als ein völlig neuer Mensch aufwachen würde, so überragend, dass es gar nicht sein kann, dass man noch derselbe ist. Nein, man ist eine völlig neue Person, mehr noch, man selbst existiert quasi nicht mehr, stattdessen ist da diese bessere Version von einem selbst – um nicht zu sagen: Ein Fremder.
Von diesem Fremden erhofft man sich vieles.
Vor allem jedoch, dass er alles besser machen wird. Das macht Sinn, denn das ist schließlich der einzige Grund für die Existenz des Fremden. Sonst hätte man ja von vorneherein man selbst bleiben können. Es ist ein Auftrag, den das vergangene Ich dem Fremden erteilt hat, ein Vertrag, der zustande kommt, ohne dass der Fremde die Möglichkeit hatte, zuzustimmen oder abzulehnen. Nicht einmal Satan himself würde auf diese absonderliche Art Verträge abschließen, aber der Homo sapiens scheint ja von jeher das hehre Ziel zu haben, den Teufel auf jedem Gebiet übertrumpfen zu wollen.
Der Fremde sieht sich am Morgen seines Erwachens nun einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Nicht gerade der Art, wie sie Herakles absolvieren musste, aber für einen Menschen (Halbgott hin oder her) sind auch diese Prüfungen von jener übermenschlichen Natur, dass man sich durchaus die Unterstützung des Göttlichen wünschen würde, um sie erfolgreich zu absolvieren:
Weniger auf Instagram und dafür mehr in Büchern doomscrollen.
Weniger Alkohol konsumieren und dafür mehr Dinge mit Vitaminen und anderem gesunden Gedöns.
Weniger am Computer abhängen und dafür mehr im Gym.
Weniger Dinge kaufen und dafür mehr Zeit mit Menschen verbring- Moment, hier muss ein Fehler vorliegen. Nein, offenbar gibt es tatsächlich Mitglieder meiner Spezies, die sich das vornehmen – was nur ein weiterer Indiz für die Unvernünftigkeit des ganzen Unterfangens der Neujahrsvorsätze ist.
Wie auch immer: All das und noch so vieles mehr soll der Fremde, den man sich um Mitternacht herbeifantasiert hat nun vollbringen. Mit atemberaubender Leichtigkeit und Verve.
Sie wissen natürlich längst, worauf ich mit diesen Zeilen hinaus möchte: Das unweigerliche Scheitern des Homo sapiens und damit ein Beleg dafür, dass das sapiens im Namen eher Dekoration ist.
Es ist nicht wirklich verwunderlich, dass in Statistiken immer wieder darauf verwiesen wird, wie kurz die Halbwertzeit der Neujahrsvorsätze ist – und damit die Existenz des Fremden. Manch Fremder segnet direkt am 01.01. das Zeitliche, zusammenbrechend unter dem Gewicht der Erwartungen – oder dem Verdauungsvorgang des 37. Raclette-Pfännchens des Vorabends.
Etwa 40 % teilen bis Ende Januar dasselbe Schicksal, bis Ende Februar ist das Massensterben dann ziemlich abgeschlossen. Wie bei einem frühzeitigen Samenerguss, den man schambedeckt unter den Teppich oder ins Taschentuch kehren möchte, kriechen die im Sektrausch prophezeiten Leichtigkeit und Verve still und heimlich ins dunkle Kämmerlein der Fantasie zurück, wo sie wie eine ruhende Herpes-Infektion schlummernd darauf warten, irgendwann erneut auf die Bühne des Geschehens gerufen zu werden. (Geben Sie es zu, Sie dachten auch nicht, dass Sie so einen Satz jemals in Ihrem Leben lesen würden.)
New year, new me, new you. Wohl kaum.
Aber der Blick sollte weg vom geradezu zwanghaften Scheitern hin zu der Frage, warum immer alles neu und anders sein soll? Und ob neu und anders auch immer besser bedeuten muss? (Und ja, das ist eine Frage, die Sie sich gerne stellen dürfen, wenn Sie das nächste Mal ein neues Smartphone kaufen wollen.)
Ich persönlich finde, dass zum Beispiel der Vorsatz, mehr und genauer auf sein Bauchgefühl zu hören, an seiner Selbstakzeptanz zu arbeiten oder einfach mal ohne Schuldgefühle ne halbe Stunde liegen zu bleiben, wenn man hingefallen ist und nicht sofort wieder aufzuspringen, die Krone zu richten und weiterzumachen, viel realistischer ist.
Liegen an sich scheint mir ein Vorhaben zu sein, das ich als Vorsatz vermutlich mit enormer Verve umsetzen würde.
Vorsätze sind also eo ipso nicht das Problem. (Eo ipso bedeutet durch sich selbst, von selbst. Ich streue hin und wieder solche Begriffe aus dem Philosophiestudium ein, um meiner Familie das Gefühl zu geben, dass es nicht komplett für die Butz war, dass ich nicht BWL studiert habe.)
Vorsätze sind vor allem dann problematisch, wenn man sie selbst eigentlich nicht umsetzen mag.
Sonst könnte man es auch am 12. April um 11:47 Uhr und hätte nicht das Bedürfnis dafür den Jahresanfang zu brauchen. Nein, man selbst mag es nicht machen, man kann es nicht, man outsourct es, der Fremde soll es richten, der am 01.01. wie der Messias himself neugeboren wird, während man selbst, das entscheidungsschwache, veränderungsunwillige Selbst zusammen mit dem Feinstaub und Ruß der Feuerwerksraketen in die Nacht entschwindet.
Wie grausam muss die Erkenntnis im Laufe des Januars sein, dass sich nicht nur die Schwermetalle der Raketen nicht in Luft aufgelöst haben – sondern hartnäckig in der Natur zirkulieren und Schäden verursachen wie die Syphillis in den europäischen Häfen des 15./16. Jahrhunderts – sondern auch man selbst nicht.
Der Fremde ist nichts weiteres als ein Klon. Eine Kopie, die mit jeder Stunde, die im Neuen Jahr vergeht, weniger unter dem Zauberbann des Placebo-Neujahrs-Effekt steht: Der Fremde scrollt genauso gerne zwei Stunden durch TikTok während er auf dem Klo sitzt, er mag Nutella lieber als Hüttenkäse und Joggen findet er eigentlich nur dann gut, wenn es darum geht, schnell in die Küche zu flitzen, um neue Snacks zu holen, bevor die Dschungelcamp-Werbung vorbei ist.
Nein, der Messias ist der Fremde ganz sicher nicht. Während jener auch dieses Jahr auf sich warten lässt und vermutlich einfach irgendwo im Jenseits herumliegt, kommt das Selbst wieder zum Vorschein und die Illusion des Fremden, der alles richten sollte, begibt sich geschlagen zur Illusion von Leichtigkeit und Verve. Schambehaftet, wie Adam und Eva, nachdem sie merken, dass sie nackelig sind, stehen wir nun da und kein Teppich, kein Taschentuch, ist groß genug, um unser Scheitern klammheimlich darunterzukehren.
New year, same me. Und das ist okay so.
Denn kein Fremder, keine Illusion eines besseren Selbst, kann die Dinge ändern, die ich geändert haben möchte. Von denen ich meine, dass sie geändert werden sollten. Jene Dinge, die keineswegs bis zum 01.01. warten sollten. Die ich heute direkt umsetzen kann. Jeden Tag ein bisschen. Und wenn ich zwischendurch hinfalle, stehe ich wieder auf.
Aber erstmal bleibe ich noch liegen und ruhe mich aus. Ein Vorsatz, den ich Ihnen allen während des gesamten Jahres nur ans Herz legen kann.